Seveso-Schutzkonzept
Der Urspung
Im Juli 1976 ereignete sich in der italienischen Stadt Seveso ein folgenschwerer Chemieunfall mit Dioxin. Der Rat der Europäischen Gemeinschaft hat daraufhin 1982 die erste Seveso-Richtlinie (Seveso I) erlassen.
Der Zweck

Das Ziel ist es, hohe Sicherheitsstandards in Betrieben zu gewährleisten, in denen gefährliche Stoffe in relevanten Mengen vorhanden sind.
Es soll das Risiko von schweren Unfällen minimieren und die Auswirkungen solcher Unfälle im Falle ihres Eintretens begrenzen.
Die Anwedungsbereiche
Die Richtlinie gilt für Betriebe, in denen gefährliche Stoffe wie Chemikalien, brennbare Gase oder explosive Stoffe in bestimmten Mengen vorhanden sind.
Je nach Menge der gefährlichen Stoffe werden Betriebe in zwei Kategorien eingeteilt: Betriebe der unteren und der oberen Klasse.
Der Ablauf (theoretisch)
Betriebe müssen eine umfassende Gefahrenanalyse durchführen, um potenzielle Risiken zu identifizieren.
Es muss ein Sicherheitsmanagementsystem etabliert werden, das die erforderlichen Maßnahmen zur Risikominimierung umfasst.
Betriebe müssen Notfallpläne erstellen, um im Falle eines Unfalls schnell und effektiv reagieren zu können.
Die Öffentlichkeit muss über die Risiken und Sicherheitsmaßnahmen informiert werden. Die zuständigen Behörden überwachen die Einhaltung der Richtlinie und führen regelmäßige Kontrollen durch.
Seveso III-Richtlinie
Die Richtlinie 2012/18/EU vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, gilt für Betriebe, in denen bestimmte Mengen dieser Stoffe vorhanden sind. Maßgebend ist das Vorhandensein in Mengen oberhalb einer Schwelle, die im Anhang der Richtlinie festgelegt ist. Für diese Betriebe gelten besondere Anforderungen an die Anlagensicherheit.
Die Richtlinie löst die Seveso II-Richtlinie 96/82/EG ab und gilt seit 1.6.2015. Sie wurde für den Geltungsbereich gewerblicher Betriebsanlagen durch die GewO-Novelle BGBl. I Nr. 81/2015 (Abschnitt 8a) idF BGBl. I Nr. 155/2016 und eine Novelle der Industrieunfallverordnung (IUV), BGBl. II Nr. 229/2015, umgesetzt.

Wo findet es Anwendung
Eigentlich überall, wo Firmen mit chemischen Stoffen auf andere Nutzungsarten treffen wie z. B. Wohngebiete. Sehr bekannte Beispiele dazu sind Leverkusen und Ludwigshafen aber auch viele kleine Städte und Gemeinden. Es hat somit nichts mit der Größe, sondern mit dem Gefahrenpotenzial zu tun und dies kann überall vor kommen.
Die Umsetzung
Wir haben bereits einige Umsetzungen hinsichtlich stationärer Gaswarnanlagen begleitet. Leider geht die Umsetzung in vielen Fällen an dem Bedarf vorbei, was wiederum zu einem falschen Sicherheitsgefühl führt.
Beispiel mit Fragen
In Leverkusen gibt es in der Nähe des Chemieparks die Auflage, dass alle Gebäude welche umgebaut oder neugebaut werden entsprechend mit einer Gaswarnanlage für die Gasarten Chlor, Chlorwasserstoff und Ammoniak ausgestattet werden müssen. Nun drängt sich als Erstes die Frage auf wer diese drei Gasarten festgelegt hat und warum?
Beispiel warum diese Frage: Auf der einen Straßenseite, außerhalb des Chemieparks müssen diese drei Gasarten überwacht werden. Direkt auf der anderen Straßenseite (nur ein paar Meter entfernt) wird jedoch mit den Chlor, Chlorwasserstoff, Schwefelwasserstoff und Kohlenmonoxid gearbeitet. Etwas weiter sind es wiederum andere Gasarten.
Dies lässt einige Fragen zur Umsetzung aufkommen.
Es geht noch weiter
Nun lassen sich die Gebäudeeigentümer außerhalb des Chemieparks entsprechende Gaswarnanlage installieren. Hierbei hat natürlich der Preis die oberste Entscheidungs-Priorität. Nun werden Gaswarngeräte verbaut, welche für diese Anwendung in dieser Form gar nicht geeignet sind.
Dies bedeutet, es werden Messstellen auf der Hausfassade platziert, so wenige wie irgend möglich. Entweder werden diese noch mit einem Wetterschutz versehen oder auch nicht. Am Ende geht es nur darum, dass die Stadt dies entsprechend absegnet. Hierbei geht es nicht um Sicherheit und um den Sinn des Konzeptes, sondern nur um den „Segen“ der jeweiligen Stadt.
Bei manchen gibt es dann bereits nach wenigen Monaten und Jahren diverse Probleme, wenn die Gaswarntechnik ganz und gar unpassend ist. Wiederum bei anderen muss zu jeder Wartung die ganze Straße gesperrt werden, was natürlich dazu führt, dass Wartungen nicht alle vier Monate, sondern einmal im Jahr stattfinden.

Die Gasarten
Nun handelt es sich bei den Gasen im hochreaktive Gasarten dessen Toxizität in niedrigen Konzentrationen überwacht wird. Oftmals liegen diese im ein- und zweistelligen PPM-Bereich. Dies führt dazu, dass sich diese Gasarten sehr stark mit Luft vermischen, von dieser beeinflusst und transportiert werden.
Kein Alarm
Im Ernstfall muss die sehr luft- und windlastige „Gaswolke“ zur Messstelle gelangen und ist in seiner Konzentration bereits sehr verdünnt. Bedeutet diese, muss direkt an die Stelle gelangen, wo die passende Messstelle/Gasart montiert ist und dann am Wetterschutzgehäuse vorbei, um dann den Sensor zu erreichen. Dieser Sensor muss durch die Wetterbedingungen, was Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw. betrifft, sich auch gerade in einem passenden Zustand befinden (geringer Drift).
Ernsthaft? Glaubt einer von den „Fachleuten“, dass dies sicherheitsgerichtet und zuverlässig funktionieren wird?
Wir „lehnen uns mal Ganze weit aus dem Fenster“ und stellen die Frage in den Raum: Wird es nicht so sein, dass die Mehrheit der Gaswarnanlagen im Fall der Fälle nicht reagieren wird?
Woran liegt es
Es liegt wie immer an der Umsetzung in Deutschland. Es werden unendlich viele Gesetze und Vorgaben gemacht. Kontrolliert werden diese jedoch nicht. Und wenn dann oftmals von Personen, dessen Fachgebiet dies nicht ist.
Genauso ist eine Gaswarnanlage ohne regelmäßige Wartung nach einiger Zeit nutzlos. Wer kontrolliert, dass diese auch funktionstüchtig gehalten werden.
Somit stellen wir fest, dass es bei der Mehrheit des Seveso-Konzeptes nicht um die Sicherheit, sondern um das Gewissen und die Beruhigung geht.
Denn wenn es wirklich um das Thema Sicherheit und sichere Funktion gehen würde, dann müsste die Umsetzung in Sachen Gaswarntechnik gänzlich anders aussehen. Und diese Umsetzung müsste dann auch entsprechend überprüft werden und nicht nur „abgenickt“.

Sicherheitsgerichtete Umsetzung
Es gibt aber auch Gebäude-Betreiber, welchen es um die Sicherheit und nicht nur um die Erfüllung dieser Auflage geht. Diese können zwar nicht die physikalischen Themen einer Gaswolke verändern, oder etwas an den festgelegten Gasarten beeinflussen, aber diese haben das Gaswarnsystem so umgesetzt, dass es im Fall der Fälle auch funktionieren wird. Dazu gehört natürlich auch eine Wartung alle vier Monate und ein frühzeitiger Sensoraustausch.
Aber sicherlich gehört dazu nicht eine Fassade mit Messstellen „vollzupflastern“. Dies funktioniert nicht und sieht auch noch bescheiden aus.
Tipp an die Ämter
Sie sollten dringend die Denkansätze und die Umsetzung überarbeiten oder das Konzept gänzlich in der Schublade belassen. So wie es an vielen Orten aktuell umgesetzt wird, ist es eine trügerische Sicherheit, welche am Ende des Tages nicht zuverlässig funktionieren wird. Wozu also die Gebäudebesitzer mit solchen Auflagen versehen. Entweder richtig oder gar nicht, wäre die richtige Herangehensweise.

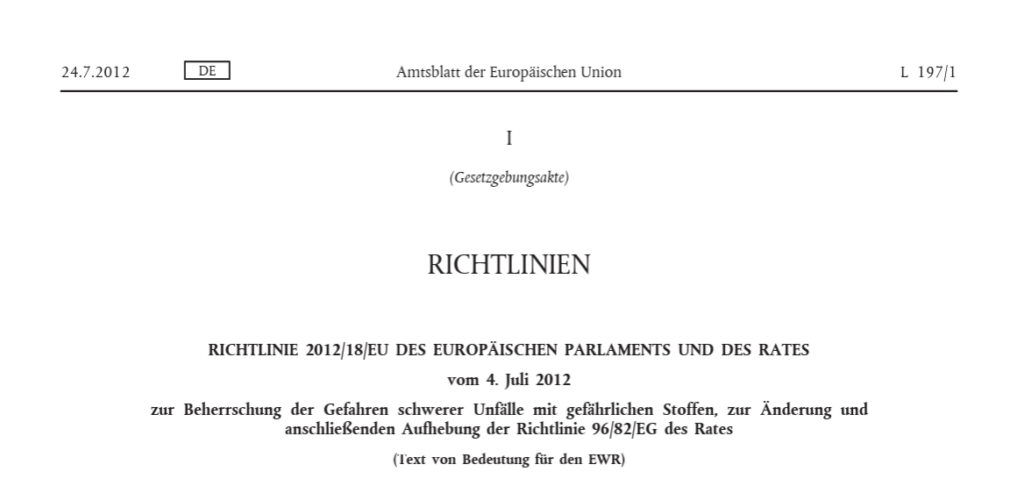
Tel. 06004 930 110
E-Mail